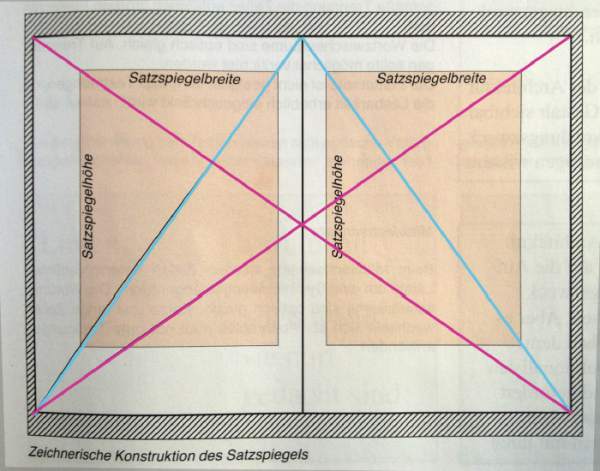Werbewirksamkeit nach AIDA:
A = Attention (Wahrnehmung der Anzeige)
I = Interest (Interesse für das Produkt wecken)
D = Desire (Den emotionalen oder pragmatischen Wunsch nach dem Produkt erzeugen)
A = Action (Kunde handelt und kauft das Produkt)
Konzeption einer AnzeigeNachdem Marketing – und Kommunikationsziele sowie die zu gewinnende Zielgruppe klar definiert sind, folgen die eigentlichen konzeptionellen Arbeitsschritte, die sich der Werbe-Strategie widmen. Werbung muss innerhalb der Marketingstrategie ihren Platz finden. Das schlägt sich sehr konkret in der Copy-Strategie nieder, womit die inhaltlichen Konzeptionen der geplanten Werbemaßnahmen gemeint sind. Grundsätzlich versteht man unter der Copy-Strategie die Ideen, Vorüberlegungen und Aufgabenstellungen für eine visualisierte und verbalisierte Umsetzung der Werbebotschaft in die entsprechenden Werbemittel. Der Auftraggeber brieft seine Werbeagentur mittels einer ausformulierten Copy-Strategie, wobei der Inhalt direkt vom Produkt- und dem Verbraucherbedürfnis, welches der Artikel erfüllen soll, abgeleitet wird. Diese hat mindestens die drei Punkte „Consumer Benefit“, „Reason Why“ und „Tonality“ zu beinhalten.
Unter dem Consumer Benefit versteht man allgemein den Produktnutzen in Form eines Versprechens ("Shampoo XY verleiht Ihrem Haar Glanz und Geschmeidigkeit" etc.). Ziel ist es einen besonderen Wert herauszufiltern, der das Produkt bzw. die Dienstleistung aus der Masse gleichartiger Angebote im Wettbewerb hervorhebt. Im Einzelnen unterscheidet man den Leistungsnutzen, der die Leistungsfähigkeit des Produktes herausstellt; den Trendnutzen, der auf die Kraft einer Gruppe setzt und beim Verbraucher den Wunsch der Zugehörigkeit weckt; den Kennernutzen, der Wissen über die Überlegenheit des Produktes demonstriert („Von Zahnärzten empfohlen“ etc.) sowie den Geltungsnutzen, dessen Ziel das Profilierungs- und Prestigebedürfnis einer Gruppe ist.
Oft erkennt man direkt mehrere der genannten Merkmale in einer Werbung. Da jedes Produkt einen bestimmten Grundnutzen aufweist, reicht der Consumer Benefit nicht aus, um die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu wecken. Zusätzlich kommt es jedoch darauf an, die Besonderheit des Produktes in einem gewissen Zusatznutzen hervorzuheben. Dieser kann in den Produkteigenschaften selbst begründet sein, aber auch durch die Produktästhetik, wie dem Design oder der Verpackung hergestellt werden. Eine weitere Abgrenzungsmöglichkeit bietet der USP (Unique Selling Proposition), der primär eine Alleinstellung am Markt durch einen einzigartigen Verkaufsvorteil hervorheben soll. Generell gilt die Aufteilung in „natürlichen USP“ (Besonderheit ist im Produkt selbst begründet) und in „künstlichen USP“. Letzteres muss jedoch die außerordentlichen Produktmerkmale erst kreieren; der verkaufte Nutzen existiert nicht real, sondern nur in der Vorstellungskraft der Zielgruppe. Der künstliche, faktisch nicht nachweisbarer USP wird somit auch UAP (Unique Advertising Proposition) genannt und finden insbesondere in Genussartikeln, wie Schokolade, Alkohol oder Zigaretten Verwendung.
Werbebotschaften haben meist den Ruf, kaum Informationen, dafür aber umso mehr manipulativer Aussagen zu enthalten. Das Produktversprechen „ Shampoo XY verleiht Ihrem Haar Geschmeidigkeit und Glanz“, reicht dem Konsumenten zur Überzeugung schon lange nicht mehr aus. Um sich von leeren Versprechungen zu distanzieren und den Kunden in seinem Kauf zu bestärken, muss die Werbung den Beweis für die Aussage mit anhängen. Realisiert wird diese Herausforderung mit dem sogenannten Reason Why, mit der dem potenziellen Verbraucher die Begründung für das Produktversprechen geliefert wird (zum Beispiel: „Dank patentierter Vitaminformel“). Dem Konsumenten wird so, allein durch den Kauf des Produktes, dass Gefühl gegeben, sich für den richtigen Artikel entschieden zu haben. Der Reason Why kann mit einem Vergleichtest, einem Härtetest, gerne bei Wasch- und Putzmitteln angewandt, und der Technik der Nutzenfacetten, bei der die Kompetenz des bewährten Traditionsprodukts auf neue Artikel übertragen wird, umgesetzt werden.
Der letzte Punkt der Copy-Strategie ist die Tonality: Der so genannte Grundton, in dem zum Ausdruck kommt, wie die Werbebotschaft verpackt werden soll. Beschäftigt wird sich mit der Frage, mit welcher einheitlichen Linie das Versprechen und die Begründung herausgestellt und vielleicht sogar bewiesen werden kann. Besonders gerne werden daher Adjektive, wie dynamisch, jugendlich, männlich, sportlich, traditionell, gebraucht. Die spätere visuelle und verbale Umsetzung hält durchgehend an der Tonality fest und kreiert eine zum Image passende Verpackung.
Mit der Copy-Strategie werden demnach werbliche Aussagen, Versprechen, Motivationen, Beweise usw. in eine einheitliche Gestaltungspolitik festgelegt. Ziel ist es, den Verbraucher lückenlos darzulegen, warum er gerade dieses Produkt kaufen soll, statt eines eventuell günstigeren Konkurrenzartikels. Das Ergebnis der Werbe-Experten, die auf der Basis der ihnen vorgelegten Copy-Strategie kreativ werden, ist natürlich nicht eindeutig, da immer auf Spielräume geachtet wird, um die Kreativität nicht einzuschränken. Im Anschluss folgt die Werbeträgerauswahl, die ebenfalls eng mit der Copy-Strategie verbunden ist. Auf der Basis der zuvor beschlossenen Schritte muss festgelegt werden, mit welchem Medium die Glaubwürdigkeit des Produktes am Besten an die Zielgruppe getragen werden kann. Eine Haarcreme für Jugendliche eignet sich zum Beispiel nicht für eine Anzeige in der Tageszeitung.
Copyright: http://koeln-bonn.business-on.de/die-copy-strategie-der-klassiker-der-werbeagenturen_id11356.html
Weiterführende Links
Anzeigengestaltung von Ralf Turtschi: http://www.publisher.ch/dynpg/upload/imgfile1483.pdf